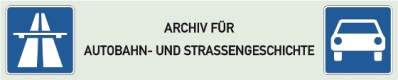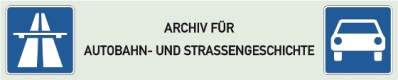|
Während es nach Verkehrsfreigabe der ersten Kilometer Reichsautobahnen zu Rast- und Parkplätzen, Raststätten und Rastanlagen schon frühzeitig, nach Verkehrsfreigabe der ersten Kilometer Reichsautobahnen, konkrete Vorstellungen und Festlegungen über Größe und Ausgestaltung gab, enthält die erschlossene Literatur erst ab 1937 Hinweise und allgemeine Ausführungen zu Straßenmeistereien (Sm). Es scheint, als ob die in Bauvorschriften formulierten Bestimmungen als ausreichend für die Gestaltung der Hochbauten von Straßenmeistereien angesehen wurden. Zu den Hochbauten einer Sm wurden Dienstgebäude, Werkstattgebäude, das Silo[2-1] für Streugut, Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Lagerhallen für sonstige, zur Unterhaltung von Straßen erforderliche Geräte gezählt. In dem 1936 vom Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen herausgegebenem Buch "Drei Jahre Arbeit an den Straßen Adolf Hitlers", einer für die Öffentlichkeit bestimmten Propagandaschrift über die erreichten Ziele, kommen Begriffe wie Straßenmeisterei, Straßenmeister oder Streckenunterhaltung nicht ein einziges Mal vor. Jedoch werden die Fahrbahnen in allen Einzelheiten beschrieben, von der Betonstärke, den eingelegten Eisen bis zur Traglast der Randstreifen. Hiermit sollte der Eindruck vermittelt werden, das "Riesenwerk", wie es Hitler beim Ersten Spatenstich deklamiert hatte, wird ohne weiteres 1000 Jahre halten.
Es ging um die NS-Ideologie und um Werbung für die Bedeutung des Reichsautobahnbaus.
 Bild 2-1: Das 1937 vom Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen herausgegebenem Buch "Vier Jahre Arbeit an den Straßen Adolf Hitlers" widmet den Betriebsanlagen, zu denen auch Tankstellen und Rastanlagen gezählt wurden einen 1¼ Seiten langen Beitrag, in welchem Zeilen zu Straßenmeistereien nur wenig Platz beanspruchen.
Bild 2-1: Das 1937 vom Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen herausgegebenem Buch "Vier Jahre Arbeit an den Straßen Adolf Hitlers" widmet den Betriebsanlagen, zu denen auch Tankstellen und Rastanlagen gezählt wurden einen 1¼ Seiten langen Beitrag, in welchem Zeilen zu Straßenmeistereien nur wenig Platz beanspruchen.
Ab 1937, mit dem Zusammenwachsen von Teilstrecken, erscheinen in den einschlägigen Zeitschriften Beiträge, die sich mit den Aufgaben von Wartung und Sicherung des Verkehrs auf den Reichsautobahnen befassen. Es werden Betriebsanlagen beschrieben, die leistungsfähig und mit den für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Gerätschaften ausgerüstet sind. Unter den verschiedenen Autoren, die über zu gestaltende Straßenmeistereien und deren Aufgaben schreiben, heben sich besonders Bruno Wehner, Fritz Doll, Paul Bonatz und Friedrich Tamms hervor.
Wie sich der Verkehr auf den Reichsautobahnen seit der Freigabe des ersten Teilstücks Frankfurt/M - Darmstadt am 19. Mai 1935 entwickelte, wurde von den Mitarbeitern beim Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen in Berlin und den Obersten Bauleitungen Reichsautobahnen (OBR) sorgfältig beobachtet. Besonders deshalb, da die neuen Strecken einer regelmäßigen Wartung bedurften, um auf Mängel des Baues sowie auf Auswirkungen der Witterung zu reagieren und die Strecken für die Anforderungen durch zunehmenden Verkehr zu rüsten. 1937 erschien im Volk und Reich Verlag Berlin das Heft 8 der Schriftenreihe der "Straße", dem Organ des Generalinspektors mit dem Titel "Der Betrieb der Reichsautobahnen - Einrichtungen für den Verkehr der Zukunft". Auf 53 Seiten bearbeiten die 13 Autoren Aspekte die der Betrieb auf den neuen Verkehrswegen mit sich brachte. Fritz Doll nennt in seinem Beitrag ab Seite 30f die Aufgaben der Straßenmeistereien, Bruno Wehner entwickelt daraus seine Vorstellungen als Verkehrsplaner, wie diese Betriebsanlagen zu gestalten sind [2-2].
Als die Kernelemente führt Wehner an:
- Räumliche Bedingungen des zu betreuenden Meistereibezirks: Größe, Lage im Gelände, Zugänglichkeit zu den Richtungsfahrbahnen
- Baulichkeiten der Straßenmeisterei: Büroräume für Führungspersonal, Räume für die weiteren Mitarbeiter, Sanitärräume, Hallen für Fahrzeuge und Geräte, Lagerhallen/-schuppen für Materialien
- Werkstattgebäude für Reparaturen an den Gerätschaften
- Siloanlagen für die Aufgaben im Rahmen des Winterdienstes
 Bild 2-2: Lageplan einer Straßenmeisterei Bild 2-2: Lageplan einer Straßenmeisterei
|
Bei Betrachtung der in Frankfurt-Rödelheim gebauten Straßenmeisterei sind die auf örtliche Bedingungen abgestimmten oben genannten Kernelemente wiederzufinden: Das Dienstgebäude, sich daran anschließend die Fahrzeughalle sowie ein Lager-/Geräteschuppen. Die Strassenmeisterei und die Tank- und Raststätte wurden, obwohl sie verschiedenen wirtschaftlichen Unternehmen zugehörig waren, von 1938 bis 1939 als eine Einheit auf gemeinsam genutztem Betriebsgelände erbaut. Architekt für beide Objekte war Hans Peter aus Offenbach. Er orientierte sich bei seiner Konzeption an den von Bonatz und Wehner entwickelten Musterentwürfen für Straßenmeistereien und passte die Hochbauten der Geländesituation an. Die Bauwerke sind im sogenannten Heimatschutzstil errichtete Typenbauten, bei denen formal-ästhetische Kriterien wie Lage in der Landschaft, bodenständiges Material und handwerkliche Gestaltung im Vordergrund standen. Das Objekt hat eine U-Form mit offenem Betriebshof zur Autobahn.
Der Sonder-Kostenüberschlag in Höhe von 570.000 RM bezog sich auf das Strassenmeistereigehöft und die Tankanlage Frankfurt/M. [2-3]. Wohnungen entstanden im Dienstgebäude und im Obergeschoss der Fahrzeughalle. Ob dafür der Finanzbedarf von 16.000 RM vorgesehen war, ist unbekannt. Für Bedienstete der Straßenmeisterei vorgesehenen Wohnhäuser abseits des Meistereigehöfts wurden nicht realisiert. Unklar ist auch, ob das Splitsilo mit angedachten 20.000 RM realisiert wurde. Der Grunderwerb von 30.000 m² (30 ha) kostete 90.000 RM, die Hofbefestigung und die Versorgungsleitungen 85.000 RM.
 Bild 2-5: Das Dienstgebäude. Links der Eingang zum Leiter der Straßenmeisterei, rechts zu den Räumen der Bediensteten. Bild 2-5: Das Dienstgebäude. Links der Eingang zum Leiter der Straßenmeisterei, rechts zu den Räumen der Bediensteten.

Bild 2-6: Grundriss von Dienstgebäude und Fahrzeughalle.
Die gesamte Gebäudekombination ist unterkellert. Dabei hatten die einzelnen Abschnitte im Kellergeschoß teils unterschiedliche Größen und Bestimmungen.
 Bild 2-7: Der Keller des Dienstgebäudes, linker Teil. Bild 2-7: Der Keller des Dienstgebäudes, linker Teil.
Im Keller links (roter Pfeil) befand sich eine Transformatorstation des Elektroversorgers. Sie war als Puffer- und Reservevariante gedacht, da das stromversorgenden Unternehmen und die Meisterei soweit auseinander lagen, dass eine solche als erforderlich angesehen wurde. Auch stand auf der anderen Seite der Autobahn ein Kabelhaus mit Verbindung zur Meisterei. Die Transformatorstation wurde etwa 1996/97 außer Betrieb genommen und entfernt. Der ehemals einzige Zugang zu ihr, ein an der Außenwand vorhandener abgedeckter Schacht mit Keller-Falltür und Leiter (grüner Pfeil), wurde zugemauert und eine Tür zum rechten Nachbarkeller eingebaut. Eine Batterie in einem separaten Raum (blauer Pfeil) lieferte bei Notfällen Energie, bis ein vorhandenes Notstromaggregat die Stromversorgung übernommen hatte.
 Bild 2-8: Der Keller des Dienstgebäudes, rechter Teil. Bild 2-8: Der Keller des Dienstgebäudes, rechter Teil.
Im rechten Teil der Kellerräume befanden sich in der Hauptsache die für den Heizbetrieb erforderlichen Komponenten: Speicherräume für Kohle und Heizöl, der Heizungsvorraum, der eigentliche Heizungsraum. Naheliegend war auch die Waschküche neben der Heizungsanlage eingerichtet.
Obwohl 1938, als mit dem Bau der Straßenmeisterei Frankfurt-Rödelheim begonnen wurde, bei der Errichtung solcher Bauten dem vorbeugenden Luftschutz bereits Beachtung geschenkt wurde, gibt es im betrachteten Objekt keine solche Einrichtung. Weder im Keller des Dienstgebäudes/der Fahrzeughalle noch extern nahe des Gehöfts sind Schutzräume zu finden. Auch die von Paul Hafen [2-4] gesichtete Literatur zu diesem Thema verzeichnet keinen Eintrag zum Findwort "Luftschutz".
 Bilder 2-9-10:
Säulengang an der Westseite des Dienstgebäudes. Säulen, teilweise erneuerter Bodenbelag und unterer Teil der Wand sind aus dunkelrotem Sandstein.
Bilder 2-9-10:
Säulengang an der Westseite des Dienstgebäudes. Säulen, teilweise erneuerter Bodenbelag und unterer Teil der Wand sind aus dunkelrotem Sandstein.
Der originale Bodenbelag hatte noch bis min. Ende 1977 Ornamente aus der NS-Zeit.
Gewöhnlich ist das Dienstgebäude getrennt von Hallen und anderen Gebäuden errichtet um dessen Funktion als das Erste unter weiteren hervorzuheben. Oft mit einem Reichsadler oder Hakenkreuz als "Schmuckelement" versehen, sollte das "Reich" repräsentiert werden, mit dem Straßenmeister als Führungspersönlichkeit.
In Frankfurt-Rödelheim jedoch sind Dienstgebäude und Fahrzeughalle unmittelbar verbunden.

 Bild 2-11: Die Fahrzeughalle Bild 2-11: Die Fahrzeughalle

Bild 2-12: Grundriss von Dienstgebäude und Fahrzeughalle.
Wenngleich die achttorige Fahrzeughalle im Inneren nur noch wenig ihres ursprüngliches Aussehens zeigt, wird nachfolgend das Überkommene betrachtet. Hilfreich sind hier ebenfalls die von Koautor Thomas Potts angefertigte Skizzen.
 Bild 2-13: Rechter Teil des Dienstgebäudes und Hallen 1 bis 4 Bild 2-13: Rechter Teil des Dienstgebäudes und Hallen 1 bis 4
Hinter den Toren der Fahrzeughalle verbargen sich durch Zwischenwände getrennte unterschiedlich genutzte separate Hallenabschnitte. So befand sich in Halle 1 eine Grube für Unterflurarbeiten. Halle 2 war noch einmal unterteilt, um der in jeder Straßenmeisterei vorhandenen Schmiede mit ihrem offenen Feuer einen eigenen Raum zu geben. Der Schornstein für das Schmiedefeuer ragte durch das Gebäude bis über den First hinaus.

Bild 2-14: Dachbereich über dem rechten Teilabschnitt des Dienstgebäudes mit dem über den First reichenden Schornstein der Schmiede.
Der noch sichtbare Schornstein am rechten Bildrand ist ein Abzug über das Dach für die Belüftung des unter Halle 2 liegenden Kellers.
|
|
Straßenmeistereien lagen in der Regel abseits von Wohnsiedlungen. Sie waren autark in vielerlei Hinsicht, besonders was die Verrichtung handwerklicher Arbeiten betrifft. Für die Holz- und Metallbearbeitung geeignete Räume waren erforderlich und sind in allen errichteten Straßenmeistereien an den Autobahnen wiederzufinden. Das als Lager- oder auch Geräteschuppen bezeichnete Gebäude macht von außen einen unscheinbaren Eindruck, doch in seinem Inneren befanden sich nicht nur die genannten wichtige Werkstätten.
 Bild 2-18: Der Lager- /Geräteschuppen Bild 2-18: Der Lager- /Geräteschuppen
 Bild 2-19: Grundriss des Lager-/Geräteschuppens. Bild 2-19: Grundriss des Lager-/Geräteschuppens.

  Bilder 2-20-22: Von der Schreinerei aus führt eine Treppe hinauf in den Dachboden. Dort zeigt sich eine interessante Dachkonstruktion.
Der Lager-/Geräteschuppen wurde ca. 1955 [2-5] erbaut und steht heute unter Denkmalschutz. Seine Dachkonstruktion ist eine technische Besonderheit. Es handelt sich um ein Leichtbaudach, das die stützenfreie Überspannung des Speicherraumes erlaubt. Ein solches Leichtbaudach ist auch bei der Sm Darmstadt zu finden.
 Bild 2-23: Dachboden des Lager-/Geräteschuppens. Bemerkenswert ist der schräg stehende Schornstein. Bild 2-23: Dachboden des Lager-/Geräteschuppens. Bemerkenswert ist der schräg stehende Schornstein.
|

Zu einem Silo in der Meisterei Frankfurt-Rödelheim für Streusalz und Streusand gibt es ein Schreiben der Direktion "Reichsautobahnen" an die OBR Frankfurt (Main) vom Dezember 1938. Darin wird ersucht, neben den Entwürfen für den Bau von 6 Einfamilienhäusern ebenfalls den Entwurf des Schuppens mit Silo alsbald vorzulegen. Auch gibt es die nebenstehende Skizze mit eingetragenem Standort für ein Silo an der Westerbachstraße (Bild 2-31:). Ob es jedoch errichtet wurde - darüber liegen keine Kenntnisse vor. Vermutlich hatte man zum Zeitpunkt der Errichtung der Anlagen keine genauen Vorstellungen über die Notwendigkeit und Größe einer solchen Anlage oder man nahm aufgrund der klimatischen Verhältnisse südöstlich des Taunus an, dass ein Silo wie es in anderen Meistereien gebaut worden war, hier nicht erforderlich sein wird.
Nachgewiesen ist ein Salz-Silo erst nach 1960, jedoch an anderem Standort.
|